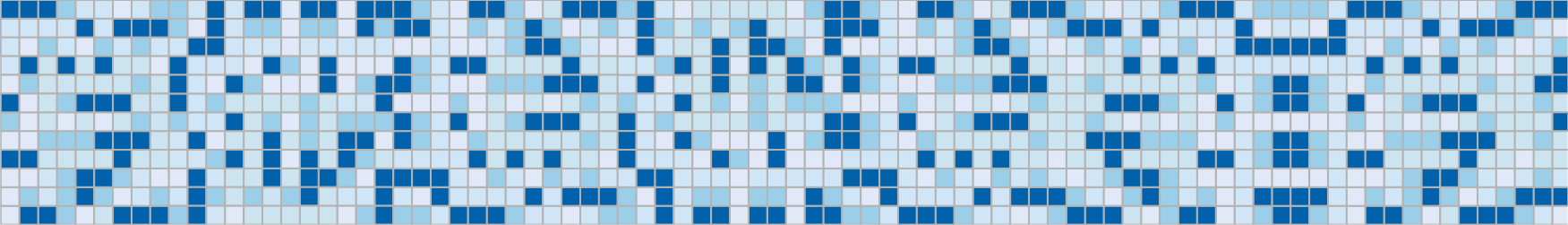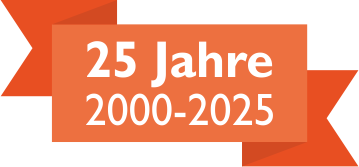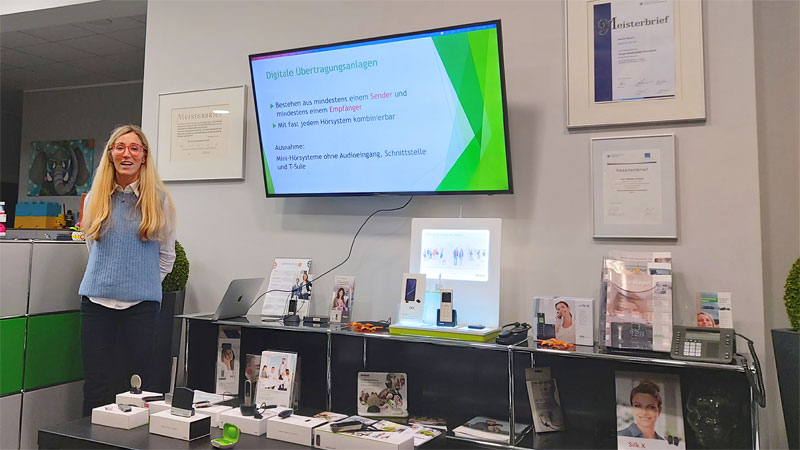Vortrag Schwerhörigkeit: Eine unsichtbare Herausforderung
Referenten: Mitglieder des DSB
Der Deutsche Schwerhörigenbund macht auf ein weit verbreitetes, aber oft übersehenes Thema aufmerksam: Schwerhörigkeit. Viele Menschen haben einen alltäglichen Umgang mit schwerhörigen Personen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Schwerhörigkeit ist unsichtbar und betrifft in Deutschland etwa 19 % der Bevölkerung über 14 Jahre, das entspricht rund 13,3 Millionen Menschen.
Die Grade der Schwerhörigkeit variieren:
- Leichtgradig: 56,5 %, ca. 7,51 Millionen Menschen
- Mittelgradig: 35,2 %, ca. 4,68 Millionen Menschen
- Hochgradig: 7,2 %, ca. 958.000 Menschen
- An Taubheit grenzend, taub oder gehörlos: 1,6 %, ca. 213.000 Menschen
Ein häufiges Phänomen bei Schwerhörigen ist die Vermeidung. Betroffene bemerken die Schwierigkeiten häufig nicht, schieben die Schuld auf andere („Die anderen nuscheln“) oder empfinden die Situation als peinlich. Sie tragen keine oder sehr unauffällige Hörgeräte, um nicht aufzufallen. Sie entziehen sich Gesprächen und sozialen Kontakten.
Verstehen hat zwei Anteile: hören und begreifen. Schwerhörigkeit erscheint deshalb fälschlich als Begriffsstutzigkeit/Dummheit (unpassende Antwort) oder Hochnäsigkeit/Arroganz (keine Antwort).
Das Risiko einer Hörbeeinträchtigung wächst mit dem Alter. Betroffen sind:
- 14-19 Jahre: 1 %
- 20-29 Jahre: 2 %
- 30-39 Jahre: 5 %
- 40-49 Jahre: 6 %
- 50-59 Jahre: 25 %
- 60-69 Jahre: 37 %
- 70 Jahre und älter: 54 %
Viele Normalhörende unterschätzen, wie schwer es für Schwerhörige ist, insbesondere unter ungünstigen Bedingungen zu verstehen, etwa bei Hintergrundgeräuschen wie Musik, Klima-Anlagen oder Geschirrgeklapper. Hörgeräte sind eine Hilfe, stellen aber die Hörfähigkeit nie vollständig wieder her (Krücke). SCHWER-Hörigkeit ist nicht LEISE-Hörigkeit. Lautstärke hilft nur wenig.
Was kann helfen?
Um Schwerhörigen zu helfen, braucht es organisatorische und bauliche Maßnahmen sowie persönliche Unterstützung:
Organisatorisch sollten Maßnahmen ergriffen werden, die eine Verständigung erleichtern, wie z.B. das Abschalten von Musik, die Nutzung von Transkriptions-Apps, die Vereinbarung von Terminen per E-Mail, das Anbieten ruhiger Räume (z.B. in Restaurants) oder die Einführung von stillen Stunden im Einzelhandel.
Baulich helfen eine gleichmäßige Ausleuchtung, akustisch günstige Materialien wie Teppiche und Vorhänge sowie schallabsorbierende Decken.
Am wichtigsten ist die persönliche Interaktion. Die Kommunikation gelingt, wenn Gesprächspartner:
- den Schwerhörigen direkt ansehen,
- langsam und deutlich sprechen,
- Geduld haben und sich bereit erklären, Dinge in anderen Worten zu erläutern,
- auf Hintergrundgeräusche verzichten.
- bereit sind, die zusätzliche Technik von Betroffenen (z.B. Ansteckmikrofon) zu nutzen.
Zusammengefasst hilft alles, was für Schwerhörige notwendig ist, auch den Komfort für Normalhörende zu erhöhen. So wird integrative Kommunikation für alle Beteiligten angenehmer und effektiver gestaltet.